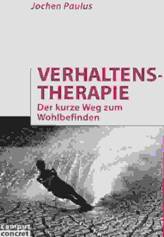|
Home |
Computerspielsucht - Eine Krankheit? |
|
Audio
herunterladen (24,5 MB | MP3) SWR2 Wissen Computerspielsucht - Eine Krankheit?Von Jochen Paulus
Sendung: Mittwoch, 25. März 2020, 08.30 Uhr Redaktion: Sonja Striegl Regie: Sonja Striegl Produktion: SWR 2020
Wenn ein Mensch länger als ein Jahr lang alle anderen Aspekte des Lebens dem Spielen unterordnet, gilt er für die WHO als computerspielsüchtig und krank. Die Kasse muss eine Therapie bezahlen.
SWR2 Wissen können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml
Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR.
Atmo: Handy-Klingeln beginnt... Der 26-jährige Anrufer will anonym bleiben. Nennen wir ihn Lars Schmidt. Er ist bereit, seine Geschichte zu erzählen. Aber nur am Telefon. Atmo: Handy-Klingeln hört auf. Um seine Anonymität zu wahren, ruft er mit unterdrückter Telefonnummer an. Wie viele andere fing er als Schüler an, ungezählte Stunden mit Computerspielen zu verbringen. Im Jugendalter habe ich noch Hausaufgaben et cetera hinbekommen. Weil ich nie Probleme in der Schule hatte, hat sich das dann auch als bewährte Strategie bewährt, nach Hause zu kommen, zu zocken und wenn man irgendwelche Hausaufgaben hatte, das morgens in der Bahn zu machen. Und so war das dann mehr oder weniger gesetzt, dass man immer, wenn man Freizeit hatte, immer wenn man nach Hause kommt, ruhig zocken kann. Auf die Dauer ging das allerdings nicht gut. Ansage: „Computerspielsucht - Eine Krankheit?“ von Jochen Paulus. Als ich dann 20 wurde und auf die Uni gegangen bin, habe ich festgestellt, dass Hausaufgaben et cetera nicht einfach so von alleine mehr gemacht werden können. Und da hatte ich dann eben das erste Mal große und arge Probleme. Dass ich festgestellt habe, Du kannst jetzt nicht für eine Klausur fünf Stunden lernen und dann schreibst Du Deine Zwei oder Deine Drei. Hier hättest Du schon zwei Wochen vorher anfangen müssen. Über die Jahre hat Lars täglich immer länger gezockt. Richtig problematisch wurde es an der Uni: . wo man dann wirklich sehr viel freie Zeit hat zum selbst organisieren, selbst studieren, ist auch alles fürs Spielen drauf gegangen. Da war das dann tatsächlich also mindestens sechs Stunden täglich. Ich denke, man könnte mit acht Stunden täglich als Schnitt schon rechnen. Musik Metal Gear Solid: Sons of Liberty Theme (anspielen und unter nächsten Sprecherin-Text) Kann das Spielen am Computer abhängig machen? Die Weltgesundheitsorganisation bejaht diese Frage. Im Mai 2019 hat sie Computerspielsucht als offizielle Diagnose in die kommende elfte Version ihres Krankheitskatalogs ICD aufgenommen. Viele Wissenschaftler waren und sind eindeutig dafür. Andere mindestens genauso eindeutig dagegen. Gut zwei Dutzend Forscher aus Europa haben deshalb ein Memorandum veröffentlicht. Darin kritisierten sie die wissenschaftliche Basis der Diagnose als schlecht. Außerdem warnten sie vor ernsthaften „Verletzungen des Rechts der Kinder zu spielen“. Aus Deutschland hat Thorsten Quandt die Protestnote unterzeichnet. Er ist Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster. So drastisch drückt er sich im Gespräch zwar nicht aus, aber er erinnert an frühere fragwürdige Ängste vor Mediennutzung. Da wurde etwa vor der „Lesesucht“ gewarnt, auch wenn das nie eine offizielle Krankheits-Diagnose war. Trotzdem sind dann Frauen in irgendwelche Therapien geschickt worden, weil man gesagt hat, deren Geist wird verwirrt, weil sie zu viel romantische Literatur lesen. Also auch da ist wahrscheinlich individueller Schaden entstanden. Comic-Lesen ist auch verteufelt worden. Andere Formen, jedes neue Medium, das aufkam, gab's diese moral panic, dass gesagt wurde, das zerstört jetzt die Gesellschaft und wir haben es mit einer Sucht oder exzessiver Nutzung zu tun. Der Ausdruck „moral panic“ bezeichnet im Englischen übertriebene Ängste um die moralischen Grundlagen der Gesellschaft, ausgelöst etwa durch ein neues Medium. Eine derartige Panik sieht Quandt bei der Reaktion auf die Computerspiele. Es gibt dann einfach Eltern, die ihre Kinder oder Jugendlichen, mit denen sie nicht zurechtkommen, dann in eine Therapie schleppen und dann sagen, behandelt den mal. Der spielt am Tag drei Stunden und ich kann nicht mehr mit dem reden. Das ist ein Problem, glaube ich, und da werden dann möglicherweise auch Leute da hingebracht und eben auch stigmatisiert, die damit nichts zu tun haben. Oder der Klassiker, dass man über die Gamer halt sagt: „Ihr seid sowieso alles Suchties, weil Ihr ein bestimmtes Mediennutzungsverhalten habt.“ Deutliche Kritik an der neuen Krankheitsdiagnose kommt natürlich auch aus der Branche selbst. In der Diskussions-Sendung SWR2 Forum sagte der Geschäftsführer von Game, dem Verband der deutschen Games-Branche, Felix Falk: Bei uns als Verband ist das auf große Kritik gestoßen. Auch weltweit, weil doch gesehen wird, dass sehr viele Wissenschaftler noch sehr stark in Zweifel ziehen, ob überhaupt genügend Grundlage, wissenschaftliche Grundlagen dafür da ist, und diese Entscheidung als sehr vorschnell betrachtet wird von einem zumindest großen Teil der Wissenschaftler. Der Streit um die Computerspielsucht tobt auch deshalb so heftig, weil die neue Diagnose nur die erste von etlichen ähnlichen sein könnte. Die Suchtkommission der deutschen kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft etwa begrüßt nicht nur „ausdrücklich“ die Einführung der Diagnose Computerspielsucht. Sie plädiert auch dafür, „medienbezogene Störungen“ ganz allgemein anzuerkennen. Das wäre genau das, was Kritiker wie Quandt befürchten. Social Media Sucht wird diskutiert, Mobile-Media wird diskutiert, und da gibt es einen ganzen bunten Strauß an modernsten Erkrankungsphänomenen, die ich mir dann ausdenken könnte. Das finde ich ein Problem, weil menschliches Verhalten sollte zunächst jetzt nur dann pathologisiert werden, wenn's auch wirklich eine Erkrankung ist, auch wirklich als solche identifizierbar. Musik / Trenner Es ist kein Zufall, wer in diesem Streit auf welcher Seite steht. Dr. Klaus Wölfling leitet die Ambulanz für Spielsucht der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Mainz. Er fasst es etwas spitz zusammen. Die Debatte führen eigentlich, so kann man es auch sagen, Personen, die eben Patienten sehen, mit Personen, die keine Patienten sehen, sondern die sich eben aus einer, sagen wir mal, medienpädagogischen Perspektive darüber Gedanken machen und da ist natürlich klar, dass da Dinge aufeinanderprallen. Suchtspezialisten wie Klaus Wölfling, die in ihren Ambulanzen viele Patienten mit massiven Problemen durch Computerspiele sehen, mögen es nicht, wenn ihnen jemand vorwirft, sie würden Computerspieler vorschnell für krank erklären. Wer stigmatisiert denn die Millionen von Spielern sozusagen? Wir rennen ja nicht raus und suchen uns unsere Patienten, sondern die kommen ja hierher quasi und suchen eben die Hilfe. Natürlich ist da immer das Argument: die Jugendlichen. Die werden natürlich auch hier häufiger sozusagen hergeschickt, weil sie noch nicht über diese Steuerungsfähigkeiten verfügen. Ich sage es aber noch mal, unsere Hauptklientel ist eben erwachsen, zwischen 20 und 30 Jahren, die kommen ja selbstständig her. Es kommt auch nicht auf die Spieldauer allein an. Natürlich spielen die Süchtigen sehr viel. Aber: Wenn jetzt jemand sehr viel spielt und dann aber trotzdem noch aktiv ist, seinen Beruf unter Kontrolle hat oder seine Ausbildung oder es gar nicht nötig hat, so viel zu lernen, zum Beispiel für die Uni, das alles mit links macht und trotzdem mit Freunden unterwegs ist, trotzdem Sport macht, sich um seinen Körper kümmert, gute Ernährung und sich bewegt und auch in sozialen Beziehungen nicht nur jetzt offline sondern auch online welche hat, aber eben auch offline welche hat, es also ausgewogen ist, dann kann man sagen, der Mensch hat keine Sucht. Anhand von Fragebögen, die es im Internet zum Beispiel auf den Seiten der SuchtAmbulanzen gibt, kann jeder selbst testen, ob er oder sie suchtgefährdet ist. Die WHO zählt folgende Kriterien für die Diagnose Computerspielsucht auf: - Eingeschränkte Kontrolle über das Spielen. - Dem Spielen wird immer mehr Priorität eingeräumt, so dass andere Interessen und Aktivitäten vernachlässigt werden. - Das Spielen wird trotz negativer Folgen fortgesetzt oder ausgeweitet. - Das Verhalten führt zu relevanten Problemen im persönlichen oder sozialen Leben und hat negative Folgen für die Ausbildung, die Arbeit oder andere wichtige Bereiche. - In der Regel bestehen die Probleme schon seit mindestens einem Jahr. Dass nichts mehr wichtig ist, außer zu daddeln und zu zocken - so war es auch bei Lars Schmidt. Wegen eines Umzugs brachen die Kontakte zu den alten Freunden ab. Interesse neue zu suchen, entwickelte er nicht. Er ging kaum noch einkaufen und hatte deshalb oft nichts zu essen im Haus. Das Schlimmste war dann zum Beispiel, dass ich lieber eine rohe Zwiebel gegessen habe, weil das am schnellsten ging und irgendwie was war, einfach aus Faulheit, aus Frust, ich weiß es nicht. Und ähnlich ist es auch mit Hygiene gewesen, ... dann geht man doch einmal oder das andere Mal ungeduscht los oder man hat einen Termin vergessen und hat dann nicht daran gedacht, sich die Fingernägel zu schneiden. Zu den typischen Phänomenen bei einer Sucht gehört, dass es nicht möglich ist einfach aufzuhören. Dieser Gewöhnungseffekt gehört auch zur Definition der Computerspielsucht. Oft leiden die Spieler unter Entzugserscheinungen, erzählt der Mainzer Suchtexperte Klaus Wölfling: Entzugserscheinungen treten vor allem auf, wenn man nicht spielen kann, klar, wenn zum Beispiel der Router ausfällt oder die Verwandten oder Bekannten einem den Router ausstellen. Da kann es eben auch zu Aggressionen kommen, innerer Spannung, aber auch zu Schlafstörungen, wenn es länger anhält. Dass man nicht mehr einschlafen kann, wenn man nicht genug gespielt hat. Oder eben auch so innere Unruhe bis hin zu Zittern sogar, das ist etwas, was sich auch körperlich bemerkbar macht. Solche Entzugserscheinungen erlebte Lars Schmidt zwar nicht. Aber er merkte, dass er das Spielen nicht mehr einschränken konnte. Sein Teufelskreis ging so: Na ja, kannst auch noch in einer Stunde anfangen. Und eine Stunde später, na ja, eine halbe Stunde kannst du noch. Na ja, jetzt wo Du sowieso anderthalb Stunden später gemacht hast, kannste auch noch mal anderthalb Stunden. Na ja, jetzt ist es schon 17 Uhr, machst du nach dem Abendbrot. Also gut, 20 Uhr fängst du an. Na gut, kannst du vor dem Schlafengehen machen und so weiter. Und so schiebt sich das immer hin und her und ich finde, Spiele, Computerspiele und Internetmedien sind wunderbar dazu geeignet, eben zu sagen, ach, nur noch eine Viertelstunde, nur noch zwanzig Minuten. Dieses Nicht-mehr-aufhören-Können, selbst wenn man aufhören will, ist der Kern der Computerspielsucht und nicht stundenlanges Spielen an sich. Viele Wissenschaftler bezweifeln allerdings, dass sich derzeit Diagnosekriterien so genau und einvernehmlich festlegen lassen, dass es zur Definition einer Krankheit ausreicht. Ist es etwa schon ein Entzugssyndrom, wenn ein Jugendlicher frustriert ist, weil die Mutter den Router abgeschaltet und so dem Spielen ein Ende gemacht hat? Oder: Wann genau wird es ernst, wenn andere Aktivitäten in den Hintergrund treten? Auch zwei Mitarbeiter von Klaus Wölfling haben einen kritischen Kommentar in der Fachzeitschrift „Addiction“ mit solchen Bedenken unterzeichnet. Umgekehrt bezweifeln allerdings selbst Kritiker wie Thorsten Quandt nicht, dass es Spieler gibt, die durch ihr Hobby ernsthafte Probleme haben. Wir haben selber qualitative Studien gemacht zu exzessiven Nutzern, also da hatten wir Fälle mit Menschen, wo die Ehe in die Brüche ging, wo das Studium gegen die Wand fuhr und so weiter. Thorsten Quandt geht es darum, was letztlich die Ursache für diese Probleme ist. Also kann ich quasi wirklich diese Argumentkette führen, dass wir hier eine spielebezogene Sucht haben, die das Spiel mehr oder weniger auslöst, wo das Spiel der Hauptfaktor und dem würde ich aus unseren Fallbeschreibungen zumindest widersprechen. Also, weil das waren eigentlich immer Fälle, wo man den Eindruck hatte, na ja, gut, da ist im Alltag einiges im Argen. Das mag schon sein, kontern die Befürworter der neuen Diagnose. Aber gilt das nicht für jede Sucht? Hinter Abhängigkeiten stehen oft ganz andere Lebensprobleme. Dem Argument, Computerspielsucht sei meist nur die Folge einer längst anerkannten psychischen Störung kann Klaus Wölfling nicht viel abgewinnen. Denn: Es gibt eine ganze Reihe von Betroffenen, die eben vorher keine psychische Störung hatten, sondern einfach nur diese Diagnose haben und ich glaube, die fühlen sich auch nicht gut abgebildet, wenn man ihnen unterstellen würde: „Mensch, Sie hatten aber vorher schon eine Depression und spielen deswegen so.“ Und das passt dann auch einfach nicht. Also das sieht man klinisch natürlich, aber auch wissenschaftlich ist das auch belegt, dass es Fälle gibt, die jetzt nicht komorbid eine, also komorbid heißt, eine andere Begleiterkrankung eben aufweisen. Aber warum spielen Spieler dann oft stundenlang und können im Extremfall kaum noch aufhören? Oft gibt es dafür einen einfachen Grund. Man spielt eigentlich, um seine Stimmung zu verbessern und irgendwann, wenn man tatsächlich eine Sucht entwickelt hat, dann muss man spielen, um in guter Stimmung zu sein. Sonst ist man quasi immer wie in so einem Entzug in so schlechter Stimmung. Musik Wie schon Kinder früh lernen, ohne übermäßiges Spielen oder sonstige fragwürdige Betätigungen schöne Momente zu erleben und mit schlechten Gefühlen sinnvoll umzugehen, lernen Schüler und Schülerinnen durch das Präventionsprogramm PROTECT (Aussprache: als Wort + deutsch ausgesprochen). Die Abkürzung steht für „Professioneller Umgang mit technischen Medien“. Es geht um soziale Netzwerke, Video- sowie Filmstreaming und auch um Computerspiele. Entwickelt wurde das Programm an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg für Schulen in Baden-Württemberg. Atmo: Klasse (etwa ab hier unter nächsten Sprecherintext) Sprecherin: Heute ist die Pädagogin Sarah Bareis zum vierten und letzten Mal für eine Doppelstunde in einer siebten Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Mannheim. In den Stunden davor hat sie mit den Kindern über spezielle Alltagssituationen fiktiver Schüler gesprochen. O-Ton 18 - Sarah Bareis (Klasse): Was hat denn der Toni gemacht, wenn er sich gelangweilt hat und nicht so recht wusste, was er machen soll? Junge: Ja, der hat halt auf Handy geschaut oder halt auf PC oder was weiß ich nicht. Bareis: Genau, also der Toni ist sehr viel ins Netz gegangen, das war das Thema. Was haben die denn alle gemeinsam, was haben denn der Toni, der irgendwie, der sich langweilt und irgendwie geht es ihm nicht so gut, er weiß nicht, was er machen sollte, der David hat Angst und ist frustriert. Und wenn wir jetzt denken an ein Mädchen oder einen Jungen, der gemobbt wird, sich einsam fühlt, was haben die gemeinsam? Junge: Alle sind direkt ins Internet gegangen, um sich abzulenken, um ihre Ängste halt eben dort, also ihre anderen Gefühle auszuüben. Bareis: Genau, also das Thema war im Netz Gefühle zu vergessen, vielleicht sich abzulenken und auch schöne Gefühle zu sammeln. Das haben wir ja auch gesehen, dem Toni und dem David ging es ja total gut im Internet. Die hatten Spaß, die hatten Spannung, die haben sich erfolgreich gefühlt, die hatten soziale Kontakte und so weiter und sofort. Etwa zwei Prozent der Jungen im Alter von 13 bis 18 leiden an Computerspielsucht, bei den Mädchen sind es nur 0,3 Prozent. Das fand das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen in einer großen Untersuchung in dem Bundesland heraus, die allerdings schon 2015 veröffentlicht wurde. Hauptschüler waren deutlich mehr betroffen als Gymnasiasten. Auch die Kinder in der Klasse des Geschwister- Scholl-Gymnasium halten sich mit dem Daddeln zurück, wie sie in der Pause der Doppelstunde erzählen. Das liegt allerdings nicht nur an ihnen selbst. Junge: Also ich spiel' nicht so sehr viel und in der Woche spiele ich vielleicht so sieben bis acht Stunden so in der Woche. Junge: Und ich darf Fortnite auch wirklich nur einmal an einem Tag spielen, das ist der Freitag und dann spiel' ich aber auch so um die drei Stunden, aber dann ist es echt Schluss, weil ich tue eher mich auf die Schule konzentrieren. Junge: Vielleicht zehn. Man muss es schon ausnutzen, ich darf ja nur zweimal die Woche. Und wenn es keine Schule gäbe, würde ich die ganze Zeit spielen. Die Kinder sollen lernen die Spielzeiten selbst zu steuern - schließlich können Eltern nicht alles kontrollieren. Durch das Programm PROTECT erfahren sie, was sie statt zu daddeln tun können, wenn sie Kummer haben oder ihnen langweilig ist. Sarah Bareis übt heute verschiedene Strategien mit ihnen. Eine davon: Achtsamkeit. Atmo: Süßigkeiten verteilen (liegt schon unter Ende des letzten O-Tons, Bareis frei, dann unterlegen) Knistern, Stimmen. Bareis: Es gibt aber nicht nur Kekse. Klasse redet, Süßigkeiten werden ausgeteilt. Dazu verteilt sie Süßigkeiten aus einer Dose: Atmo: Süßigkeiten verteilen (wieder hoch und kurz frei, und noch kurz unter nächsten Sprecherintext) Bareis: Hat jeder eines? Nehmt euch eines. Welche Farbe hat sie, glänzt sie oder ist sie matt, wie riecht sie? Die Schüler sollen sich nun ganz auf ihre Süßigkeit konzentrieren. Du darfst zubeißen. Wie fühlt es sich beim Kauen an? Verändert sich der Geschmack? Die Süßigkeit schmeckt auf einmal ganz anders, wenn sie achtsam genossen wird, stellen die Kinder fest: Weil ich jetzt mal nur mich darauf konzentriere, normalerweise stopfe ich mir das einfach in den Mund und so, jetzt überlege ich mal, wie das so aufgebaut ist eigentlich, wie das eigentlich so schmeckt, auf der Zunge zergehen lassen, was unsere Zunge damit überhaupt macht. Es geht nicht um mehr Genuss beim Essen von Süßigkeiten. Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Strategie anwenden können, wenn sie Angst haben, etwa vor einer Klassenarbeit. Allerdings müssen sie erst einmal auf einer Skala von null bis zehn abschätzen wie stark ihre Angst ist. Denn für extrem negative Gefühle taugt die Methode nicht. O-Ton 22 - Sarah Bareis (ab „Mädchen“ unterlegen): Also zwischen einer Vier und wenn man noch bei einer Sechs ist, würde ich sagen, kann man die Strategie gut nutzen. So, ihr sitzt jetzt da. Ihr denkt die ganze Zeit an die Arbeit und Ihr seid so richtig in Runterzieher-Gedanken. Wie kann diese Strategie denn in dem Moment helfen? Wer hat eine Idee, was macht die Strategie? Was macht Ihr? Ihr esst ganz langsam ein Stück Schokolade oder geht achtsam duschen. Mädchen (unverständlich Man kriegt andere Gedanken) „Man kriegt andere Gedanken“, sagt eine Schülerin. Im Idealfall würde sie sich in einer solchen Situation nicht an den Computer setzen um zu spielen. Ganz andere Vorstellungen vom Umgang mit jugendlichem Frust haben die Hersteller von Computerspielen. Eine Werbung für das ab 12 Jahren erlaubte und bei Minderjährigen populäre Spiel „League of Legends“ klingt so: O-Ton 23 -
Werbevideo League of Legends: Kein Leben, kein Geld? Perfekt, brauchst du alles nicht. Leg‘ los und finde heraus, was dir liegt. Jeder hat eine Rolle. Wie ein Job, nur nicht so unglaublich ätzend. Magst Du Schwerter oder lieber Raketen? Zauberst gerne oder erlegst Viecher. (unverständliches Wort) deine Freunde, spielst solo, weil du keine Freunde hast, ganz egal, mach einfach. Wow, mein Leben hat jetzt einen Sinn. Traurig, aber wahr. League of Legends. Spiel’s doch mal. Der Fachverband Medienabhängigkeit kritisierte den Spot als zynisch und urteilte, Computerspiele, die jugendspezifische Risikofaktoren gezielt aufgriffen, beinhalteten „ein besonders hohes Suchtpotenzial“. Der Hersteller verteidigt sich so: „Der Tonus unserer Werbung soll den Humor des Spiels unterstreichen.“ Wenn allerdings Kinder und - vor allem junge - Erwachsene vom Spielen kaum noch loskommen, liegt das nicht nur daran, dass sie nicht mit unangenehmen Gefühlen umgehen können. Die Spiele sind so gemacht, dass sie dazu verführen, immer weiter und weiter zu spielen. Oft verdienen die Hersteller erst dann. Der Mainzer Computerspielsucht-Experte Klaus Wölfling erläutert den geschickten Mechanismus: So kleine Handy-Spiele, wo man zunächst großen Progress hat, also viel Erfolg hat im Spiel, man merkt dann plötzlich, wird immer schwieriger, ich komme nicht weiter in so einem Aufstieg, ob Sie jetzt an einem Landwirtschaftsspiel oder Autorennspiel oder sonst irgendwas denken und irgendwann kommen Sie aber nicht mehr weiter. Das ist natürlich bewusst so gemacht und dann kommt aber das Angebot etwas einzusetzen, um dort weiterzukommen im Spiel, also ein Euro oder zwei oder drei oder ein paar Cent. Musik: Metal Gear Solid / Splinter Cell: Conviction (unter nächsten Sprecherintext) Dafür gibt es beispielsweise einen nützlichen Gegenstand, der weiterhilft. Auf die Dauer summieren sich die Kleckerbeträge. Daher erstaunt es, dass Felix Falk vom Verband der deutschen Games-Branche behauptet, es läge gar nicht im Interesse der Hersteller psychologische Tricks anwenden, um die Spieler zum Weiterspielen und Geldausgeben zu verführen: Das ist dann natürlich auch am spannendsten wirtschaftlich gesehen für ein Unternehmen, wenn nicht einer sagt man, oh Mann, jetzt merke ich, ich übertreibe es völlig und deinstalliere mein Spiel jetzt lieber, ehe ich dann exzessiv spiele. Ne, die wollen ja eher eine Langfrist-Verbindung zum Spieler haben. Viel Geld verdienen die Hersteller auch mit virtuellen Artikeln, die nur der Verschönerung dienen, etwa schicken Klamotten für die Spielfigur, sogenannten Skins. Ein prominentes Beispiel ist „Fortnite“, das oft genannt wird, wenn es um Computerspielsucht geht. Seine Gefahren haben sich bis zu den Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums herumgesprochen. Beliebt ist das comichafte Ballerspiel trotzdem. Junge: Es ist halt eben kinderfreundlich, es ist ab zwölf und es gibt viele Menschen, die übertreiben es halt eben mit dem Geld. Also sie geben halt sehr viel Geld für dieses Spiel aus, beispielsweise durch Skins oder so. Obwohl jeder Skin eigentlich gleichzeitig ist, es sieht halt nur eben anders aus. Musik: Splinter Cell: Conviction (unter nächsten Sprecherintext) Besonders umstritten sind so genannte Loot-Boxen, die Spieler in vielen virtuellen Welten finden und kaufen können. Oft steckt in ihnen nur relativ wertloser Plunder, sie können aber auch seltene Kostbarkeiten bergen - das zeigt sich erst nach dem Kauf, beim Öffnen. Loot-Boxen sind also Glückssache und ihr Verkauf deshalb nahe an einem Glücksspiel, für das die Spielehersteller eine Lizenz bräuchten. In Belgien sind Loot-Boxen verboten, in Deutschland gelten sie offiziell nicht als Glücksspiel. All diese Angebote können erhebliche Folgen für Spieler haben, warnt Suchtexperte Wölfling: Die können dann eben auch dazu führen, dass manche Personen eben sehr viel Geld investieren, was sie gar nicht haben vielleicht und dann eben da über ihre Verhältnisse investieren und dann bis so im fünfstelligen Bereich die Schulden kommen, über 10.000 Euro oder so, die jetzt nur für Items, so sagt man, die in Spielen eben verwendet werden. Wenn sie nicht einfach nur schön sind, sind die teuren Einkäufe aber letztlich nur Mittel zum eigentlichen Zweck: dem Weiterkommen im Spiel. Je nach Genre sind viele Rätsel zu lösen oder viele Gegner zu besiegen und jeden dieser Erfolge erlebt der Spieler als belohnend. Wenn er die Chance auf eine solche Belohnung hat, schüttet sein Gehirn Dopamin aus - den gleichen Botenstoff, der auch bei der Sucht nach Drogen eine große Rolle spielt. Klaus Wölfling und seine Mitarbeiter haben mit Hilfe eines Magnetresonanztomografen oder eines EEGs erfasst, in welchen Momenten im Spiel die Erregung im Gehirn steigt. Wir sehen eben vor allem der Spieleinstieg, Aufstieg, der wird eben hocherregend verarbeitet und eben zum Beispiel auch ein Kill, also jemand anders zu töten, wird von süchtigen Spielern erregender verarbeitet eben als von Spielern, die moderat spielen. Und da sieht man, dass eine Veränderung in diesem Stoffwechsel stattfindet, der uns anzeigt: Was ist eine belohnende Sache? Auch diese Veränderungen in den Reaktionen des Gehirns sind wohl dafür verantwortlich, dass es sehr schwer sein kann, die Computerspielsucht zu überwinden. Eigentlich ist es die Aufgabe der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, Jugendliche durch Alterskennzeichnungen vor für sie gefährlichen Spielen zu schützen. Deren Suchtpotenzial kümmert die USK aber nicht, wie aus einer Antwort an SWR2 Wissen hervorgeht. Was an einem Spiel die Suchtgefahr erhöhen könnte, sei ja wissenschaftlich umstritten. Deshalb bleibt bis auf weiteres alles erlaubt. Musik: Splinter Cell: Conviction (unter ersten Teil des nächsten Sprecherinnentexts) Lars Schmidt schaffte es nicht aus eigener Kraft, seine Sucht zu überwinden. Er entschied sich für eine Therapie und landete schließlich bei Klaus Wölfling in ambulanter Behandlung. Obwohl es dort bei Bedarf auch Einzelstunden gibt, findet die Therapie vor allem in der Gruppe statt. Lars Schmidt war froh, andere mit ähnlich massiver Computerspielsucht zu treffen. Bis dahin dachte er, nur bei ihm seien die Probleme so extrem. Sie redeten darüber, wie sie so süchtig werden konnten, aber auch über ihr Verhalten. Vor allem natürlich Spielverhalten und welche Probleme es dabei gibt, wenn man abstinent sein möchte, sozusagen. Wie kann man damit umgehen, wenn man ein Missgeschick hat, also dass man wieder rückfällig geworden ist? Das ist die entscheidende Frage: Wie der Versuchung widerstehen? Gegen Ende der 15 Sitzungen umfassenden Therapie konfrontiert ein Therapeut den Teilnehmer direkt damit. Die beiden setzen sich an einen Computer, an dem der Patient spielen könnte. Da haben viele Patienten dann auch so Rückfallängste, die sagen, jetzt führen Sie mich ja wieder ran, hier so, das sehen wir eigentlich nicht so kritisch. Weil wir denken, diese Auseinandersetzung damit ist sehr gut auch zu erleben: Ich kann darauf verzichten, auch wenn jetzt jemand da bei mir sitzt und irgendwie sein Auge drauf hat. Trotzdem setze ich mich in dem Moment eben damit auseinander, versuche quasi mich dem zu stellen. Die Therapie wurde in Mainz, Tübingen, Mannheim und Wien im Rahmen einer Studie überprüft, wobei nicht nur Computerspielsüchtige, sondern auch Internetabhängige teilnahmen. Bei 59 von 72 Teilnehmern hatte sich das Problem am Ende deutlich gebessert. In der Kontrollgruppe war die Quote niedriger. Ziel der Therapie ist, nicht mehr zu spielen. Während der Therapie ist das sechs Wochen lang sogar streng vorgeschrieben. Allerdings sind längst nicht alle Teilnehmer sicher, ob sie das wirklich wollen. Der Verzicht fällt schwer, einige müssen während der Therapie sogar in eine Klinik aufgenommen werden. Lars Schmidt glaubt, dass er nun den für sich richtigen Umgang gefunden hat. Wenn ich das mal in Zahlen fassen müsste, gibt's mal eine Woche, in der ich zehn Stunden spiele, mal eine Woche, in der ich zwanzig Stunden spiele und mal eine Woche, in der ich gar nicht spiele. Und dann gibt es mal zwei oder drei Wochen, in denen ich bloß insgesamt eine Stunde spiele, es variiert sehr stark. Aber es ist nicht mehr sechs bis acht Stunden täglich, sieben Tage die Woche et cetera, et cetera. Dass die WHO die Computerspielsucht zur Krankheit erklärt hat, hat für die Spieler, die davon loskommen wollen, einen positiven Effekt. Die Krankenkassen müssen die Therapie bezahlen, sobald die Neufassung auch in Deutschland eingeführt wird. * * * * * |